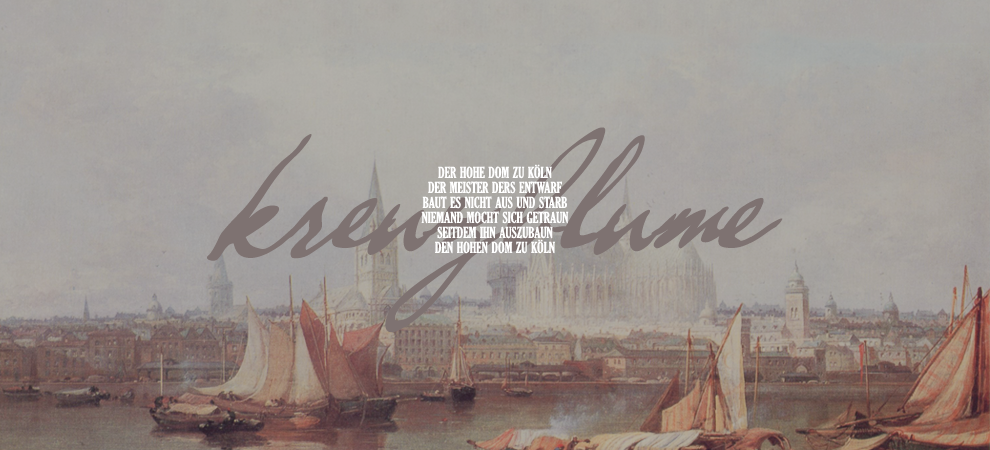| Bildung in der Freien Reichsstadt Köln | |||||
|
Bildung in der Freien Reichsstadt Köln
Das Schul- und Bildungssystem bis 1798
Das Bildungssystem bis 1798 in der Freien Reichsstadt Köln war auf die Vermittlung von Grundkenntnissen für die einfache Bürgerschaft und die höhere Bildung für die oberen Gesellschaftsschichten ausgelegt. In den Jahren bis zur französischen Besetzung gab es keine Schul- oder Unterrichtspflicht, der Besuch der Schulen war somit freiwillig und gerade in ländlichen Gegenden, wo Kinder in der Regel als Arbeitskräfte gebraucht wurden, nicht an der Tagesordnung.
Auch in der Stadt besaßen Kinder aus armen Familien kaum mehr als die Fähigkeit ihren eigenen Namen zu schreiben. Von der Aufklärung, die sich eigentlich der Bildung aller Gesellschaftsschichten verschrieben hatte, profitierte somit hauptsächlich das einfache Bürgertum (Händler, Angestellte), das seine Kinder nicht als Geldverdiener brauchte. Da Schulen mittlerweile sowohl für Mädchen, als auch für Jungen vorgesehen waren, stieg der Bildungsgrad des durchschnittlichen Kölner Bürgers enorm. Für die Unter- und Mittelschicht vorgesehene Schularten waren
Die Kölner Oberschicht bildete ihre Kinder in der Regel mit dem Hintergedanken aus, sie später studieren zu schicken. Hauptbestandteil der frühen Ausbildung war somit neben Rechnen, Lesen und Schreiben vor allem das fließende Beherrschen der lateinischen Sprache. Hierfür wurde sowohl auswendig gelernt (z. B. der gesamte de bello gallico oder die ilias), als auch in beide Richtungen übersetzt. Da Frauen nicht studieren konnten, erhielten junge Mädchen meist eine Grundausbildung im Rechnen, Lesen und Schreiben, wurden aber hauptsächlich auf die Organisation eines Haushaltes sowie in weiblichen Künsten, wie dem Sticken unterrichtet. Zu gebildete Frauen waren damals nicht gern gesehen, da höhere Bildung dem Mann vorbehalten war. Auch die Erben reicher oder einflussreicher Familien wurden selten Studieren geschickt. Sie erfuhren zwar die gleiche Bildung wie ihre jüngeren männlichen Geschwister, wurden aber auf das Führen des Familiengeschäftes, des Landguts oder des gesamten Besitzes vorbereitet. Familien, die ihre Söhne studieren schicken wollten, sich einen Privatlehrer aber nicht leisten konnten, oder einfach Wert auf den Schulbesuch legten, schickten sie unterdessen auf
Die Universität gestaltete sich damals anders als heute. Es gab nur drei höhere Fakultäten: Die Medizinische Fakultät, die Juristische Fakultät und die Theologische Fakultät. Einen einheitlichen Studienbeginn gab es nicht, eine Studiengebühr, die ärmeren, begabten Schülerin erlassen werden konnte, wurde bei der Einschreibung erhoben. Die Universität in Köln war sehr elitär und wurde hauptsächlich von Söhnen höherer Familien besucht. Um an einer der höheren Fakultäten zu studieren, musste man zuerst die Artistenfakultät besuchen. Die Lehrsprachen an der Artistenfakultät waren Latein und Deutsch.
Nach dem Besuch der Artistenfakultät war man für ein Studium an einer höheren Fakultät zugelassen. Auch hier waren die Lehrsprachen Latein und Deutsch.
Absolventen der höheren Fakultäten wurden hoch geschätzt und konnten nun als Ärzte, Juristen oder Theologen arbeiten oder promovieren. Mit einem Doktorgrad konnten sie schließlich selbst als Professor an einer der höheren Fakultäten lehren. Die Universität in Köln wurde 1798 geschlossen und als Universität erst wieder im Jahr 1918 eröffnet. |
||||
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Wetter
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
News
25.11.2020 » Es schreitet voran! Die Beta-Phase lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten und somit kommt auch die Eröffnung immer näher! Leider musste Tini aufgrund beruflicher Verpflichtungen als Technik-Admin zurücktreten, dafür haben wir aber nun Nana an Bord, die uns auf den letzten Metern mit Codes und Know-How unterstützt! Die größten Baustellen sind momentan noch design-technische Kleinigkeiten, ein paar Profilinformationen, Verlinkungen und die Texte. Bleibt gespannt!
Kalender
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du hast eine Frage oder es gibt Probleme, dann wende dich gerne ans Team! HIER siehst du eine Übersicht aller Teammitglieder, deren Aufgaben und Kontaktmöglichkeiten.